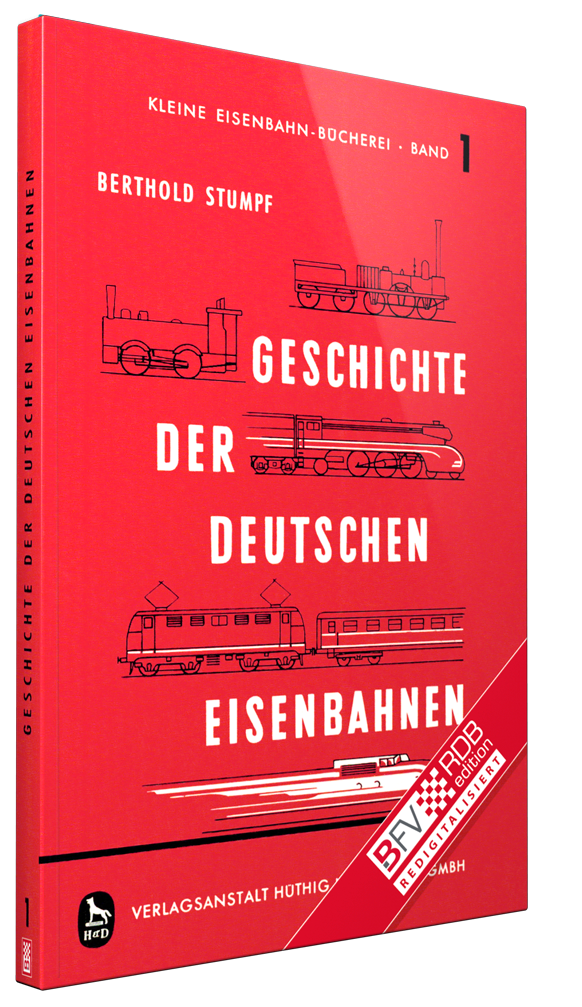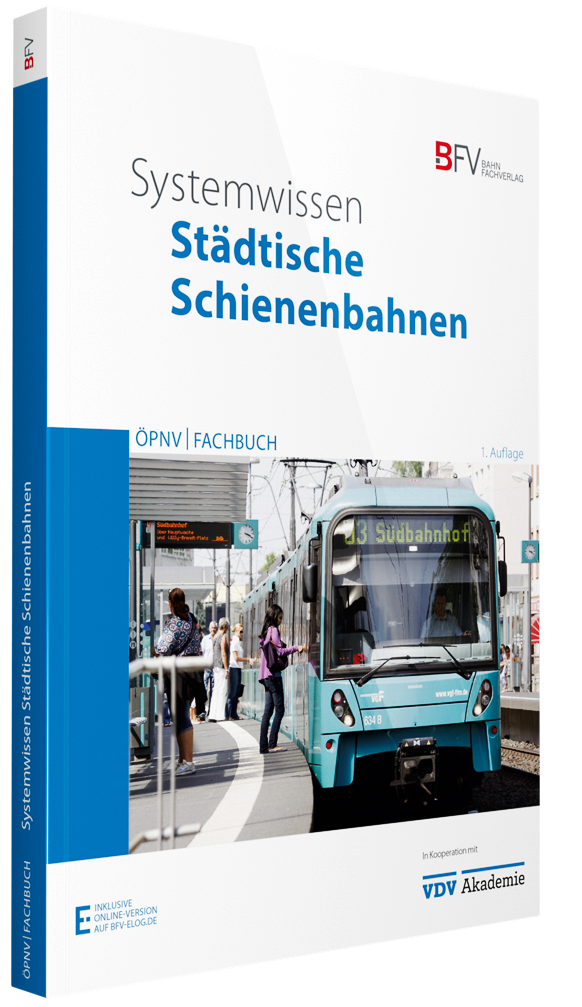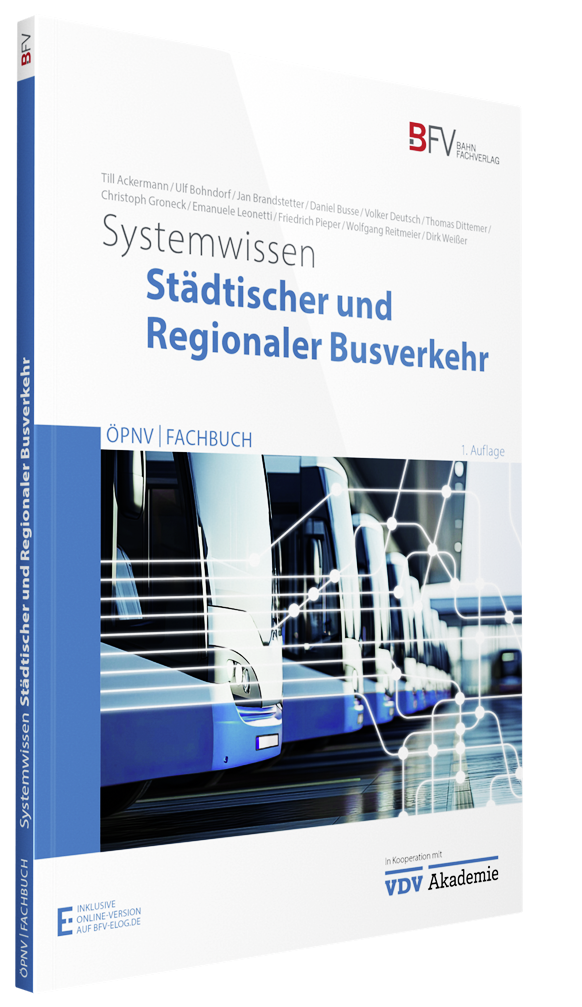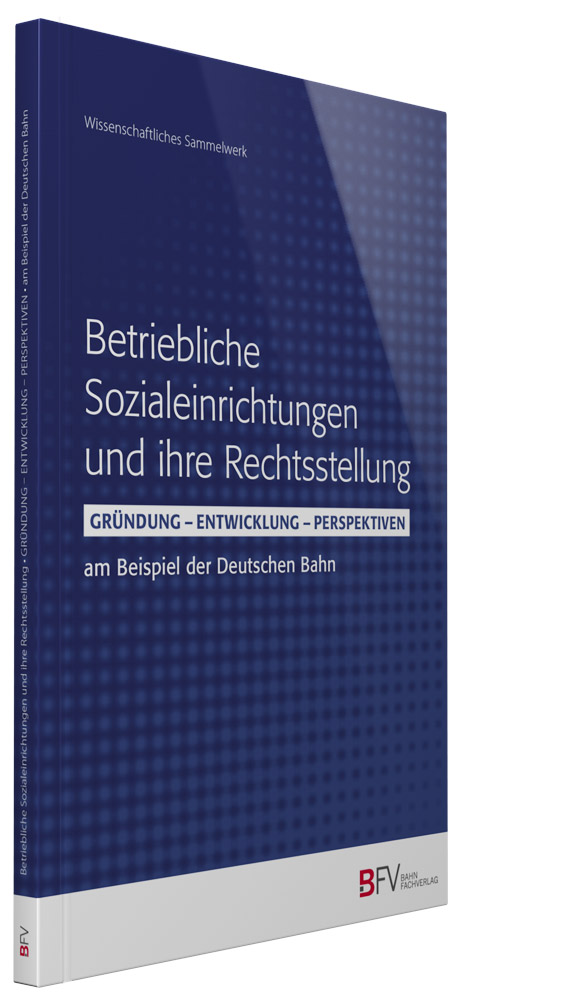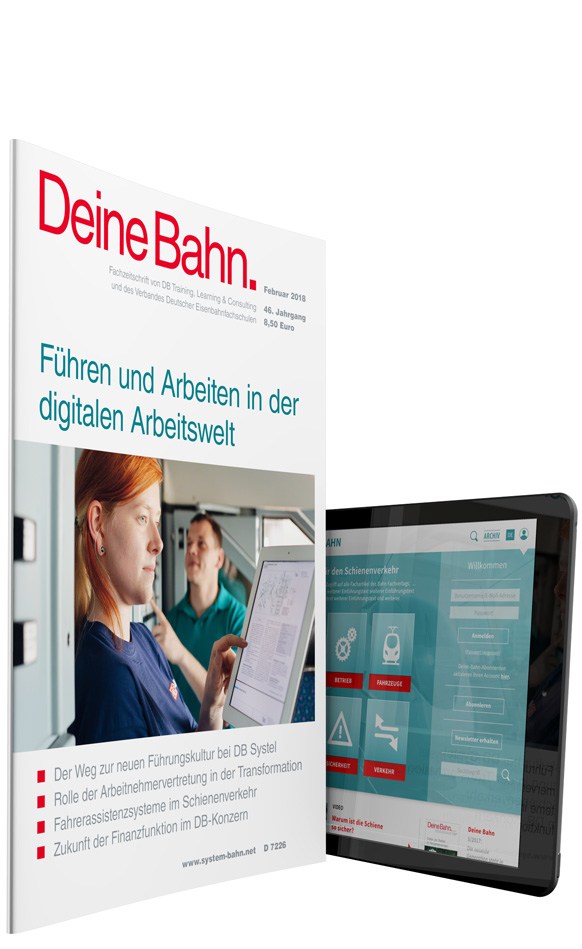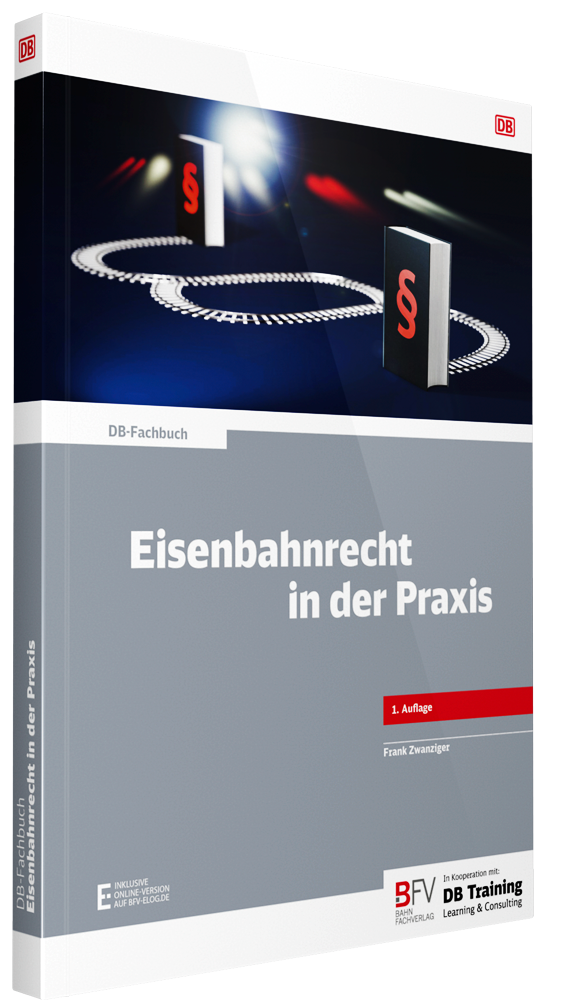Zum ihrem traditionellen Jahresauftakt hatte die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft erstmalig nach Berlin geladen. Das Saarland, seit diesem Jahr eine Modellregion für integrierte Alltagsmobilität, stellte dafür seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Austausch der versammelten Expert*innen und Praktiker*innen aus Politik und Wissenschaft drehte sich um die Kernfrage, wie attraktive Angebote dort entstehen können, wo das Auto noch alternativlos erscheint.
Mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung lebt in ländlichen Regionen, die 80 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands ausmachen. Dort sind Menschen auf funktionierende Mobilitätsangebote angewiesen, doch die Infrastruktur ist oft unzureichend. Lange Wege, sinkende Einwohnerzahlen und fehlende Angebote im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stellen große Herausforderungen dar.
Vor diesem Hintergrund hatte die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (DVWG) den „Tag der Verkehrswissenschaft“ in diesem Jahr dem Thema Mobilität im ländlichen Raum gewidmet. Die Fachtagung begrüßte ihre Gäste in der Hauptstadtvertretung des Saarlandes, das gemeinsam mit der Deutschen Bahn ein innovatives Modellprojekt ins Leben gerufen hat. Geleitet und koordiniert wird dieses Projekt vom Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz, die DB-Tochter Regio unterstützt mit konzeptioneller und technischer Expertise.
Die federführende Ministerin Petra Berg betonte in ihrer Eröffnungsrede, das Thema Mobilität habe im sehr ländlichen und vom Autoverkehr geprägten Saarland einen hohen Stellenwert. Wenn Angebot stimmt, so Berg, dann seien die Menschen auch bereit, das Auto stehen zu lassen.
Entwicklung des ÖPNV als Chance für Kommunen
Berg verdeutlichte den Zusammenhang zwischen einem ergänzenden Angebot zum motorisierten Individualverkehr und der Ansiedlung von Menschen und Unternehmen in ländlichen Räumen. Investitionen in den ÖPNV, so die Ministerin, sollten daher nicht nur als Kostenfaktor betrachtet werden, da sie Mehrwert schaffen und damit der Entwicklung der Kommunen zugutekommen können.
In der Modellregion Saarland testen die Projektpartner neue Mobilitätsformen in sogenannten Reallaboren. Marie Dornoff von DB Regio und Dr. Christian Ramelli vom zuständigen Ministerium präsentierten die Vorgehensweise des Projektes, das Bahn, Bus, On-Demand- und Sharing-Dienste kombiniert.
Ausgehend vom regionalen Schienenverkehr spielt das PlusBus-Netz die Schlüsselrolle für das Erschließen des Hinterlands, ergänzt von diversen Angeboten für die letzte Meile und dem Ausbau von Radwegen. Auch der ÖPNV kann dem Bedürfnis nach individueller Mobilität entgegenkommen, stellten die Referenten klar. Damit die Angebote zur Zielgruppe passen, wurden zuvor umfangreiche Datenanalysen zu Bevölkerung und Mobilitätsverhalten gemacht.
Die große strukturelle Vielfalt, die sich hinter dem Begriff des ländlichen Raums verbirgt, zeigte Professorin Christine Eisenmann von der BTU Cottbus-Senftenberg auf, die zugleich die Tagung moderierte. Sie machte deutlich, dass Mobilität im ländlichen Raum aus Sicht der Wissenschaft als interdisziplinäre Herausforderung betrachtet werden muss.
Die politische Dimension sprach DVWG-Präsident Prof. Christian Ninnemann an. Er hofft auf richtige Weichenstellungen nach der Bundestagswahl, was die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs betrifft, und benannte demografischen Wandel und Digitalisierung als weitere wesentliche Einflussfaktoren.
Unterschiedliche Voraussetzungen in den Ländern
Im Anschluss moderierte Ninnemann ein politisches Panel, das sich mit den notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Mobilitätswende auseinandersetzte. Neben Ministerin Berg nahmen Rainer Genilke, Vizepräsident des Landtages Brandenburg sowie die Landräte Patrik Lauer (Saarlouis) und Udo Recktenwald (St. Wendel) auf dem Podium Platz und berichteten über ihre Konzepte und Erfahrungen aus der Praxis.
Die Bürger erwarteten ein attraktives Angebot, dass sie ohne Auto ans Ziel bringt, wie gut getaktete Verbindungen in die größeren Städte, sagte der Vertreter Brandenburgs Genilke. Eine Herausforderung sei es aber, den Schienennahverkehr in dem Flächenland wirtschaftlich zu betreiben, da die Kosten angesichts der dünnen Besiedlung und langen Distanzen im Verhältnis zur Nachfrage relativ hoch ausfallen.
Wieder anders stellte Landrat Recktenwald die Situation im Landkreis Wendel dar, der sehr dörflich ist und gleichzeitig über eine starke lokale Wirtschaft und eine hohe Pkw-Dichte verfügt. Es dürfe nicht darum gehen, den Menschen das Auto zu vermiesen, sondern es als ein Baustein im Angebot zu sehen.
Wenn ÖPNV, dann richtig, lautet dagegen die Devise in Saarlouis: Der Kreis spart nicht bei Qualität, Komfort und Sicherheit, erläuterte Landrat Lauer, denn die Kundenzufriedenheit sei der entscheidende Erfolgsfaktor.
Wie sich multimodale Verkehrsstrategien in ländlichen Gebieten erfolgreich umsetzen lassen, verdeutlichte Ralf Nachbar vom Rhein-Main-Verkehrsverbund. Bei On-Demand-Verkehren müsse eine regional einheitliche Qualität gewährleistet werden, betonte Nachbar, daher dürfe das Angebot nicht allein privaten Dienstleistern wie Uber überlassen werden.
Noch wichtiger als eine hohe Taktfrequenz schätzt er aus Kundensicht die Verlässlichkeit der Verkehre ein. Eine Hürde sei dabei die zu große Vielfalt untereinander nicht kompatibler IT-Systeme für Information und Fahrscheinkauf – nicht jeder Verkehrsverbund oder Verkehrsanbieter benötige eine eigene App.

Mobilitätswende heißt auch Bewusstseinswandel
Das verbleibende Drittel der Tagung war wieder voll und ganz der Wissenschaft gewidmet. Zunächst bekam der Hochschul-Nachwuchs eine Bühne: Vier Studierende und junge Forschende stellten in Kurzpräsentationen ihre Ansätze vor: die Ermittlung der Potentiale von Carsharing, Typologien der Fahrradnutzung, reisendenzentriertes Störungsmanagement und das Aachener Rail Shuttle.
Im abschließenden wissenschaftlichen Panel wurden verschiedene Forschungsperspektiven zur Mobilität im ländlichen Raum vorgestellt. Dr. Antje-Mareike Dietrich (WVI Verkehrsforschung), Miriam Dross (Umweltbundesamt), Prof. Jeanette Klemmer (FH Münster) und Melanie Schade (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) diskutierten mit dem Publikum über die Herausforderungen und Potenziale neuer Mobilitätskonzepte.
Im Fokus standen unter anderem Fragen zur besseren Bedarfsanalyse und zur Bedeutung sozialer Aspekte. So dürfe nicht vergessen werden, dass es eine erhebliche Zahl von Haushalten gibt, die sich kein Auto leisten können oder eines haben, obwohl es für sie zu teuer ist, sowie Menschen ohne Führerschein und ältere Alleinstehende. Diese Menschen sind aus Sicht der Forschung eine Zielgruppe, die für alternative Mobilitätskonzepte gewonnen werden kann. Auch der Radverkehr habe demnach noch viel Potenzial im ländlichen Raum.
Ebenso müssten jüngere Menschen positive Erfahrungen mit öffentlichen Verkehrsangeboten sammeln können, um der in Deutschland sehr autofreundlich geprägten Sozialisation etwas entgegenzusetzen. Die vorhandenen Angebote sollten bekannter und präsenter sein, sprich: Zur Mobilitätswende gehört auch ein Bewusstseinswandel.
Lesen Sie auch:
- Wie Digitalisierung den ÖPV fit für die Zukunft macht
- „Die Kommunen brauchen mehr Anreize für umweltfreundliche Verkehrspolitik“
- Pkw im ÖPNV: Eine zukunftsfähige Kooperation
- Kommunale Verkehrsplanung
- Best-Case-Bahnhöfe im ländlichen Raum gesucht
- Neue Mobilität Paderborn: Verkehrslösung für den ländlichen Raum
- MONOCAB – Ein innovatives Schienenfahrzeugkonzept
Artikel als PDF laden