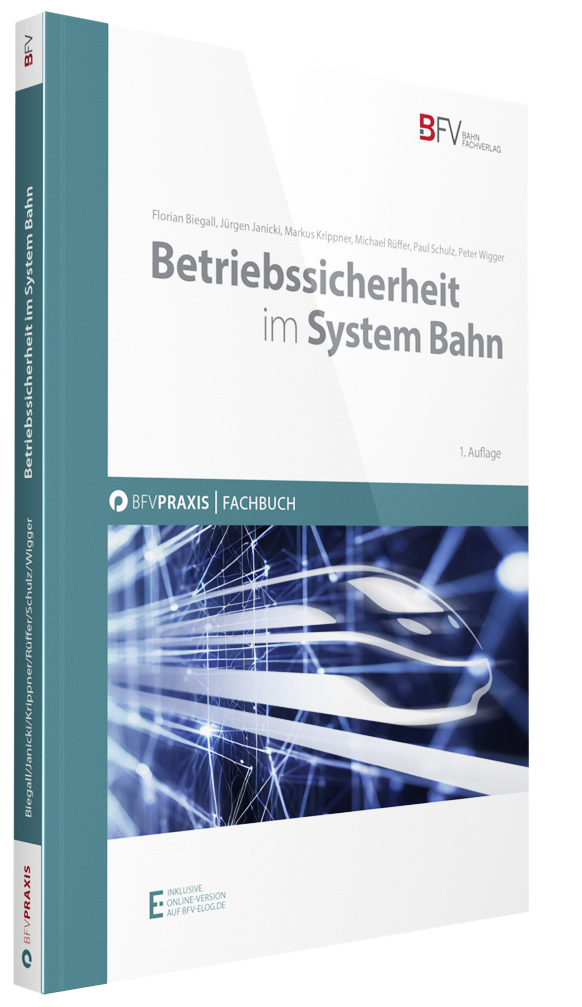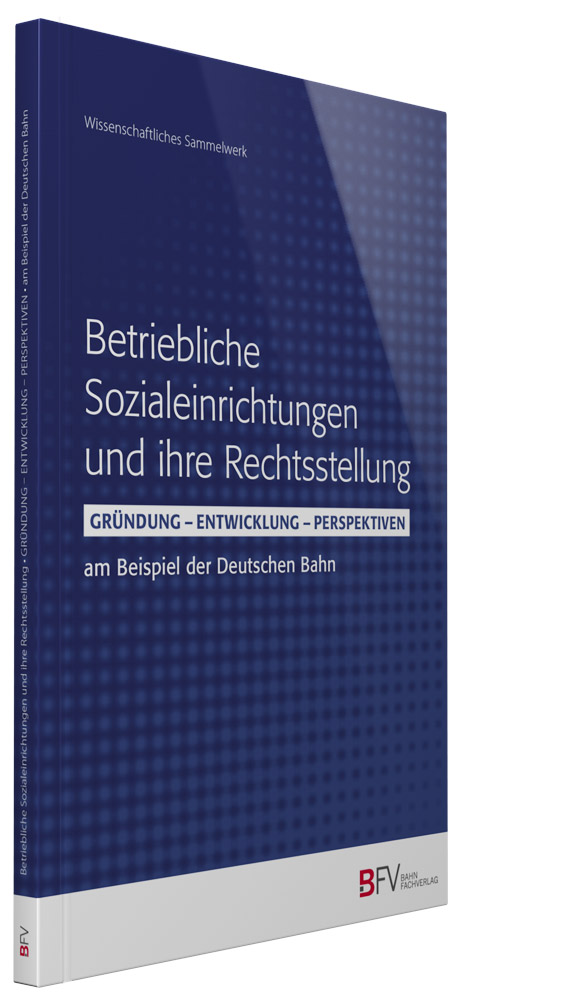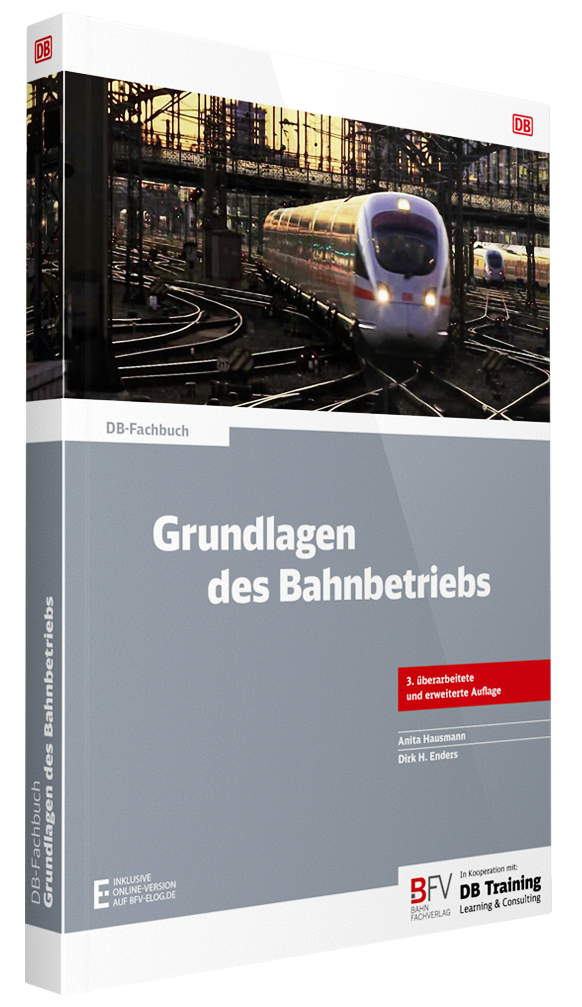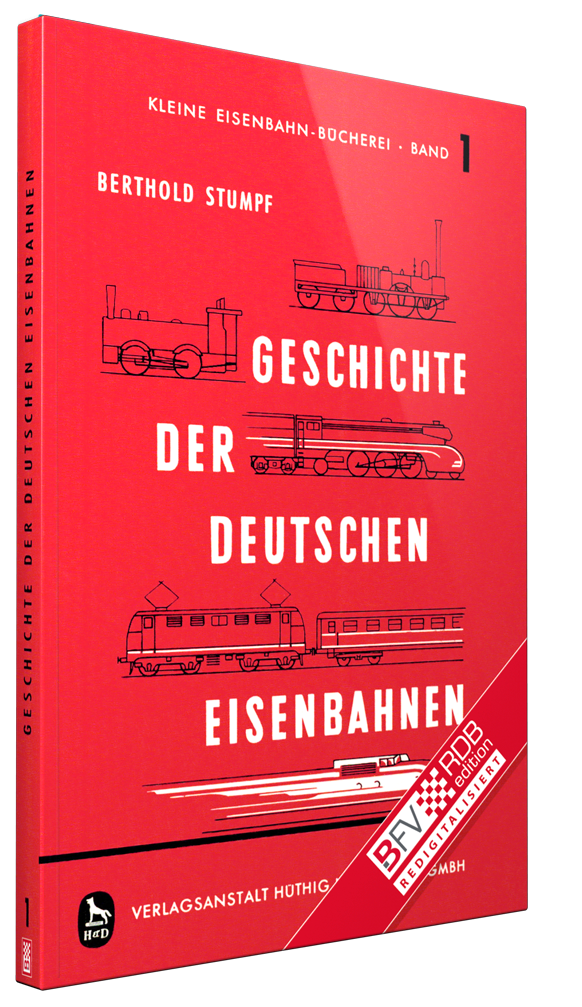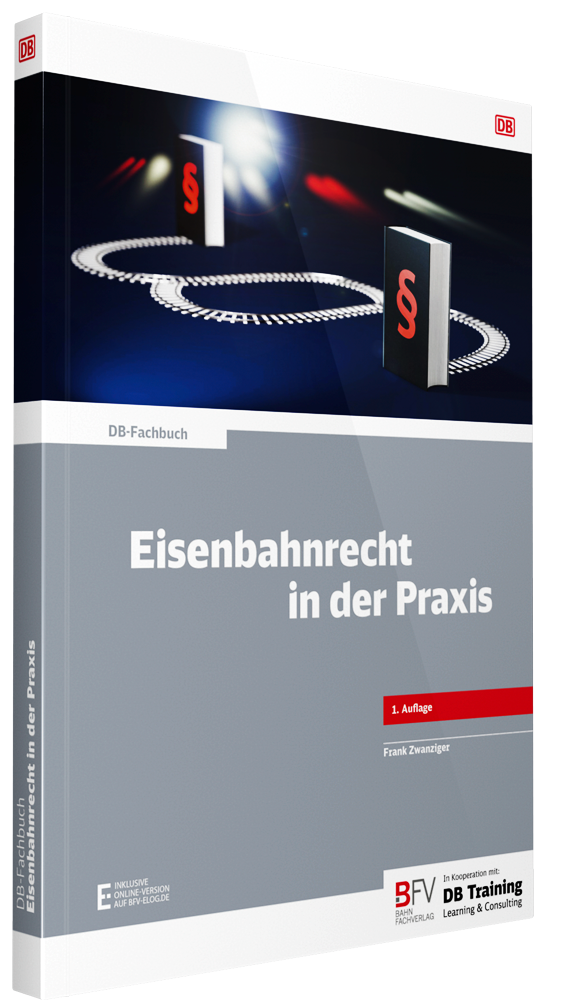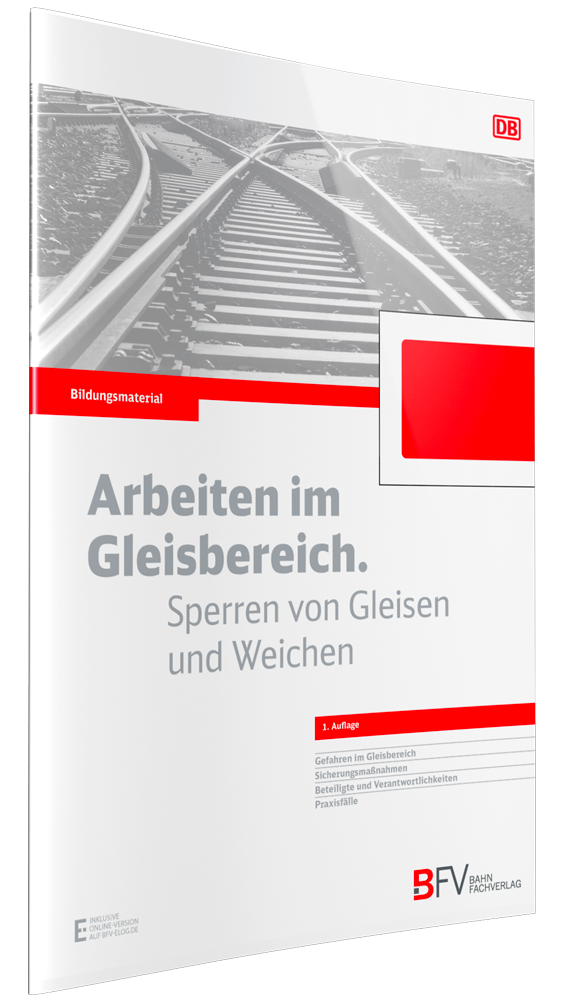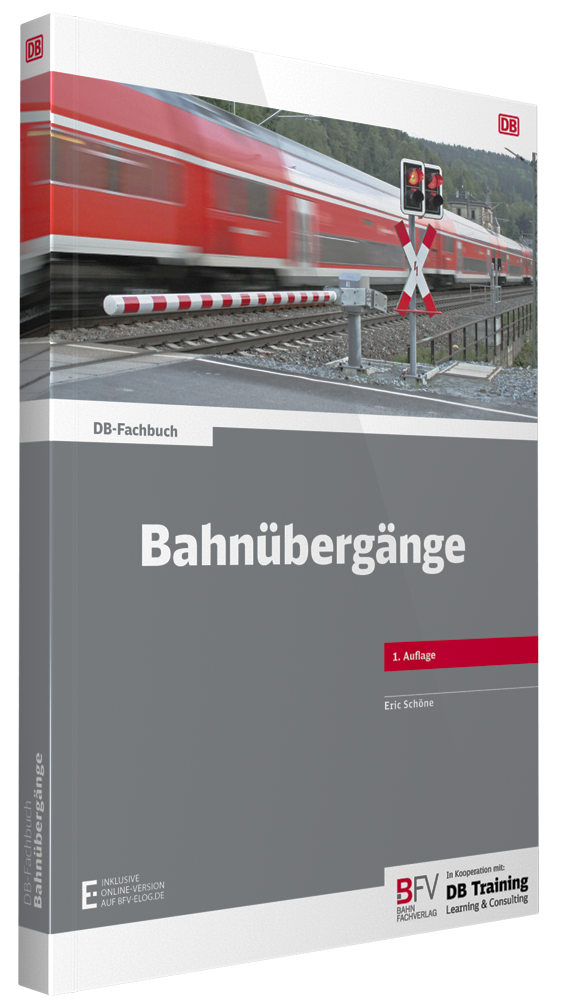Auf der Rail Human Factors-Konferenz an der TU Berlin sorgten die Teilnehmenden für einen internationalen und interdisziplinären Blick auf den sogenannten Menschlichen Faktor in einem System Bahn, das sich in Zukunft weiter digitalisieren und automatisieren wird.
Artificial Intelligence (AI) bzw. Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde – unter anderem auch dann, wenn es um die Weiterentwicklung des Systems Bahn geht. Weder die bestehenden Kapazitätsengpässe noch der Fachkräftemangel werden, da sind sich alle Expert*innen grundsätzlich einig, ohne eine weitergehende Digitalisierung und Automatisierung zu bewältigen sein.
Derzeit ist es nur theoretisch denkbar, dass eines Tages eine AI ein sicherheitskritisches System wie die Schiene vollautomatisch und in Eigenregie steuern wird. Dieses Faktum rückt das Zusammenspiel von Mensch und Technik in den Mittelpunkt sicherheitsrelevanter Betrachtungen, zumal sich das System Bahn mit zunehmender Automatisierung kontinuierlich wandelt und dabei auch neue Anforderungen an die Menschen in ihren beruflichen Funktionen stellt.
Unter dem Strich ist also klar: Menschliche und organisatorische Faktoren (MOF) sind von entscheidender Bedeutung für Sicherheit sowie Effizienz des Bahnbetriebs, und es ist inzwischen gesetzlich verpflichtend, dass MOF in den Sicherheitsmanagementsystemen der europäischen Bahnen berücksichtigt werden müssen.
Konferenz
Auf der 6th German Conference on Rail Human Factors, die im Februar an der TU Berlin stattfand, informierten sich Mitarbeitende von Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Unternehmen und Verbänden über den Stand der Dinge beim Thema „Human Factors“. Eingeladen hatten zu der englischsprachigen Konferenz der Fachbereich für Bahnbetrieb und Infrastruktur (BBI) an der TU, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Unternehmen Siemens.
Die zweitägige Veranstaltung bot einen Mix aus Frontalvorträgen, Podiumsdiskussionen und der Arbeit in thematisch geclusterten Kleingruppen, der den Stand der Forschung in so unterschiedlichen Teilbereichen der Human Factors wie Nutzerfreundlichkeit, Methoden, Sicherheitskultur, Übermüdungserscheinungen bei Triebfahrzeugführenden sowie Anwendungen beispielhaft veranschaulichte.

„Past the hype“
Marc Burkhardt von der Siemens Mobility GmbH machte den Anfang mit seinem Vortrag, in dem er den zunehmenden Einsatz von AI für das sogenannte User Experience Design (UX), also die Benutzerfreundlichkeit von Produkten beschrieb. Burkhardt betonte die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von AI für UX, insbesondere bei generativer (Kreation neuer Inhalte in Text, Bild und Ton) und dialogorientierter AI (Mensch-Maschine-Interaktion in menschlicher Sprache).
Gleichzeitig warnte er aber auch vor den Gefahren, die der AI-Einsatz mit sich bringen kann: von der potenziellen Verletzung von Rechten der Privatsphäre und des geistigen Eigentums über Herausforderungen im Bereich IT-Security bis zu möglichen negativen mentalen Auswirkungen auf die Nutzenden (zum Beispiel Entscheidungsschwäche und geistige Trägheit). Auf Nachfrage von Gastgeberin Prof. Dr.-Ing. Birgit Milius, Leiterin des BBI-Fachbereichs an der TU Berlin, ob es sich bei AI letztendlich doch „nur“ um einen Hype handeln könne, verneinte Burkhart in aller Deutlichkeit („We are past the hype“) und warb dafür, die Chancen zu sehen, die in der Nutzung von AI liege, ohne deren Gefahren zu ignorieren.

Vorträge und Diskussionen
Die weiteren Vorträge und Diskussionen auf der Konferenz boten einen interdisziplinären und internationalen Überblick über die Aktivitäten in Hochschulen, Institutionen und Unternehmen im Bereich Human Factors:
Justin Adam von der TU Berlin stellte die jüngste Testphase des geförderten Forschungsprojekts „ARTE“ („Automatisiert fahrende Regionalzüge in Niedersachsen“) vor, in dem die TU zusammen mit den Projektpartnern DLR und Alstom den Nachweis der technischen Machbarkeit erbracht hat, Züge via Mobile Device zu steuern.
Richard Bye vom britischen Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) Network Rail veranschaulichte, was die Kognitionswissenschaften in Bezug auf Human Factors leisten können: Grundsätzlich gehe es darum, die menschliche Perspektive in die Gestaltung technischer Prozesse miteinfließen zu lassen, sagte Bye. So sei die zentrale Frage für einen Fahrer in einem hochautomatisierten System, wann er diesem trauen könne – und wann nicht. Dies zu erkennen und entsprechend umzusetzen, müsse bei einem „Decision Centered Design“ im Zentrum stehen.
Sarah Kusumastuti stellte ein Forschungsprojekt der Universität Twente und des niederländischen EIU ProRail vor: Mithilfe von Literaturrecherchen und Expert*innen-Interviews stellten die Wissenschaftler*innen einen Werkzeugkasten (toolkit) für Human Factors-Methoden zusammen, der aus unterschiedlichen Quellen stammt und somit eine fachübergreifende Vergleichbarkeit schafft.
Wie wichtig es generell ist, über die unterschiedlichen Ansätze in den Human Factors nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene unterrichtet zu sein, dokumentieren auch die Bemühungen der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA), über die Sicherheitskulturen der europäischen Bahnen informiert zu sein und diese zu evaluieren: Krzysztof Zubilewicz informierte über den Stand dieses Projekts bei der ERA.
Auch die Schweizer Perspektive wurde mit zwei Vorträgen von der Fachhochschule Nordwestschweiz berücksichtigt: Die Wissenschaftler*innen stellten zum einen mit der Entwicklung eines gemeinsamen Trainingskonzepts für Mitarbeitende in den Betriebszentralen und vor Ort (zum Beispiel im Notfallmanagement) ein klassisches Schnittstellenthema vor. Außerdem warb die Hochschule für den Ansatz, die Themen Safety, Security und IT-Sicherheit konsequent gemeinsam zu denken, wie es im Übrigen im Bahn-Vorzeigeland Schweiz bereits in die Praxis umgesetzt wird: Die SBB hat die drei Themenbereiche inzwischen in einer einzigen Unternehmenseinheit zusammengefasst.
Wie weit die Entwicklung der Sicherheitskultur bei der Deutschen Bahn bereits vorangetrieben worden ist, namentlich bei der DB Regio AG, dem größten europäischen EVU, und bei der DB Fernverkehr AG, veranschaulichten Jacqueline Kroker und Ole Kroczek in ihrem Vortrag (siehe auch den Leitartikel in der Februar-Ausgabe von Deine Bahn).
Mit der frühzeitigen Erkennung von Müdigkeits- und Erschöpfungssymptomen bei Triebfahrzeugführenden beschäftigten sich gleich zwei Vorträge: So stellte Nora Balfe ein Projekt der Irischen Bahn vor, in dem ein kamerabasiertes Monitoringsystem zur frühzeitigen Erkennung von Erschöpfungssymptomen getestet wurde. Und Esther Bosch fasste die Ergebnisse eines Gemeinschaftsprojekts von DLR, TU Chemnitz und dem Smart Rail Connectivity Campus in Annaberg-Buchholz zusammen, in dem die Testteilnehmenden in unterschiedliche „Erschöpfungszustände“ versetzt und dann im Rahmen einer 15-minütigen Testfahrt mit einem differenzierten Sensoren-Instrumentarium überwacht wurden.
Darüber hinaus stellte Kristin Mühl vom Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) eine Studie zu liegengebliebenen und stark verspäteten Zügen vor, in der vor allem mangelnde oder unzureichende Kommunikation in Bezug auf MOF festgestellt wurde – übrigens vor allem bei liegengebliebenen Zügen und bei Verspätungen eher im Regional- als im Fernverkehr.

Fazit
Die 6th German Conference on Rail Human Factors an der TU Berlin bot an der Schnittstelle von Theorie und Praxis einen international und interdisziplinär angelegten Überblick zum Einsatz und zum Stand der Forschung zu „Human Factors“. Dabei wurde deutlich, dass es auf nationaler wie internationaler Ebene derzeit noch an systematischen Vergleichsmöglichkeiten fehlt, in welchen Bereichen und Fakultäten zum Thema geforscht und gearbeitet wird. Allein diesen Mangel zu beheben, wäre eine große Hilfe, das Potenzial, das in den MOF liegt, zu erkennen und zu nutzen.
Lesen Sie auch:
- Wenn die Sicherheitskultur greifbar wird
- Die Sicherheitskultur im System Eisenbahn (Teil 1)
- Die Sicherheitskultur im System Eisenbahn (Teil 2)
- Die Sicherheitskultur im System Eisenbahn (Teil 3)
- Die Wiederentdeckung des „Faktors Mensch“ im Eisenbahnsystem
- Der Faktor Mensch im Sicherheitsgefüge der Eisenbahn
- Menschliche und organisatorische Faktoren einer gemeinsamen Sicherheitskultur
- Der Mensch im System Bahn
Artikel als PDF laden