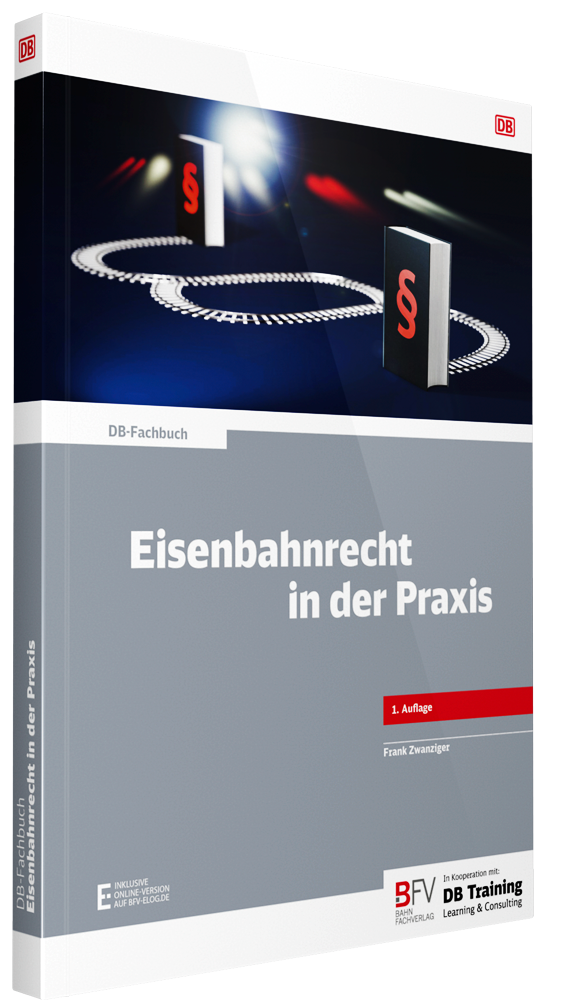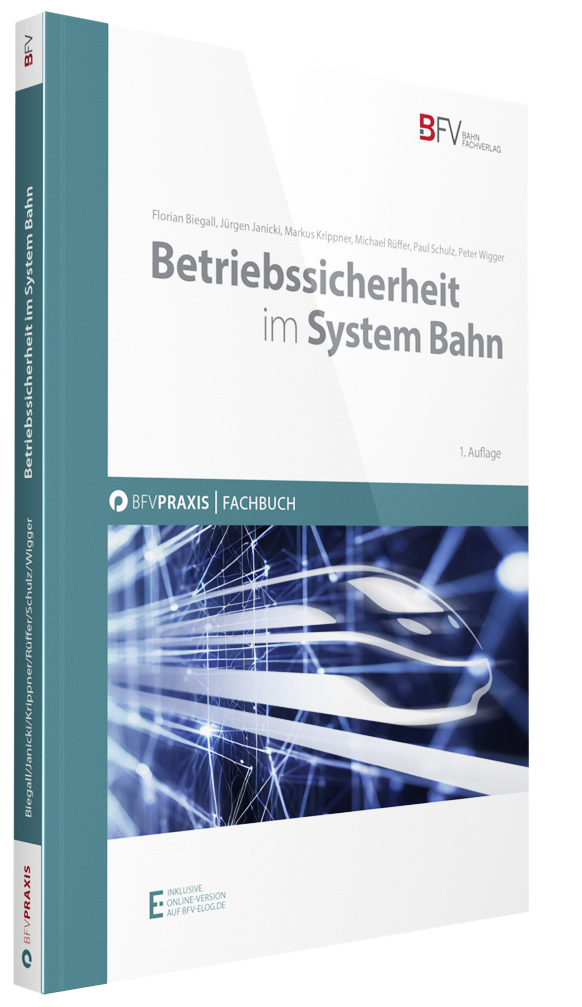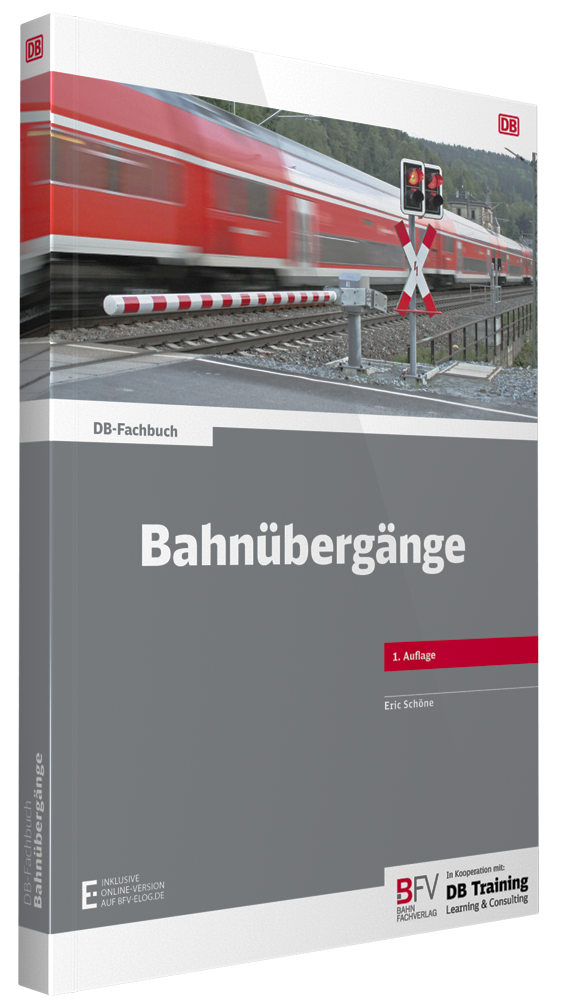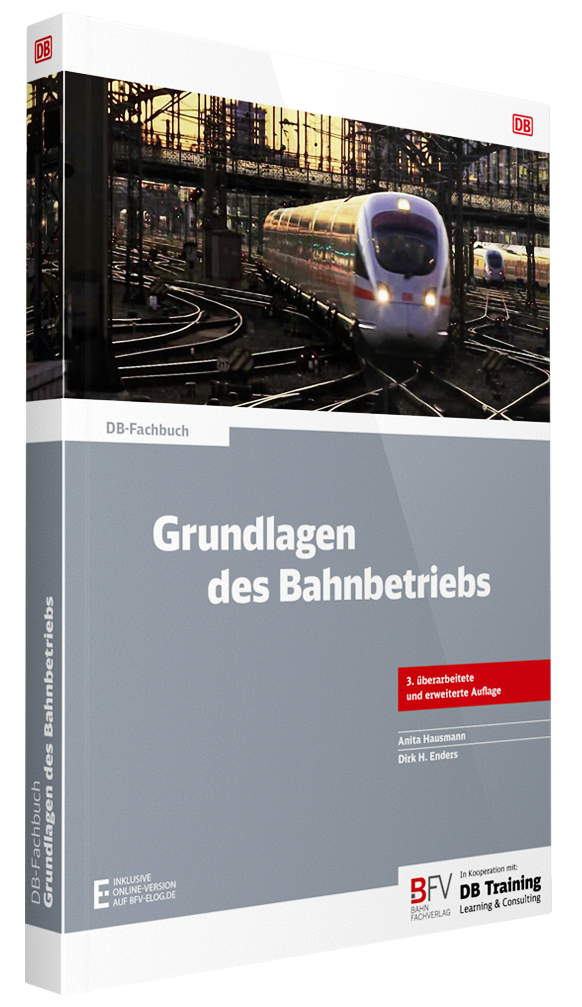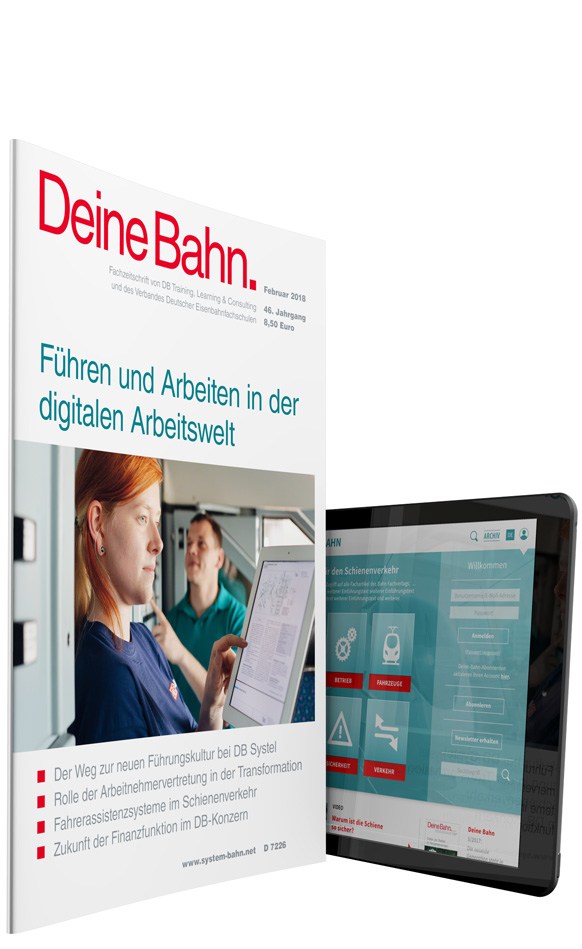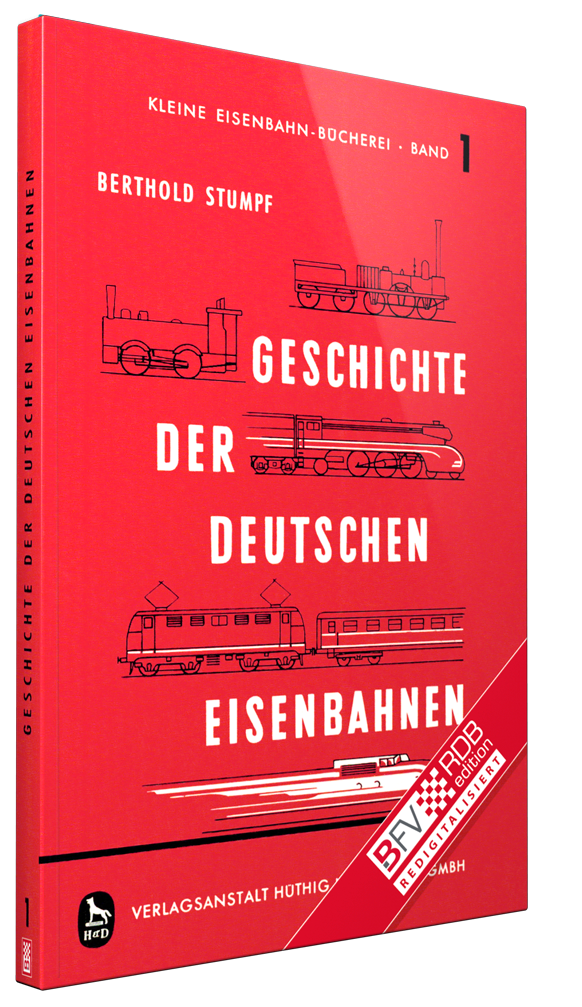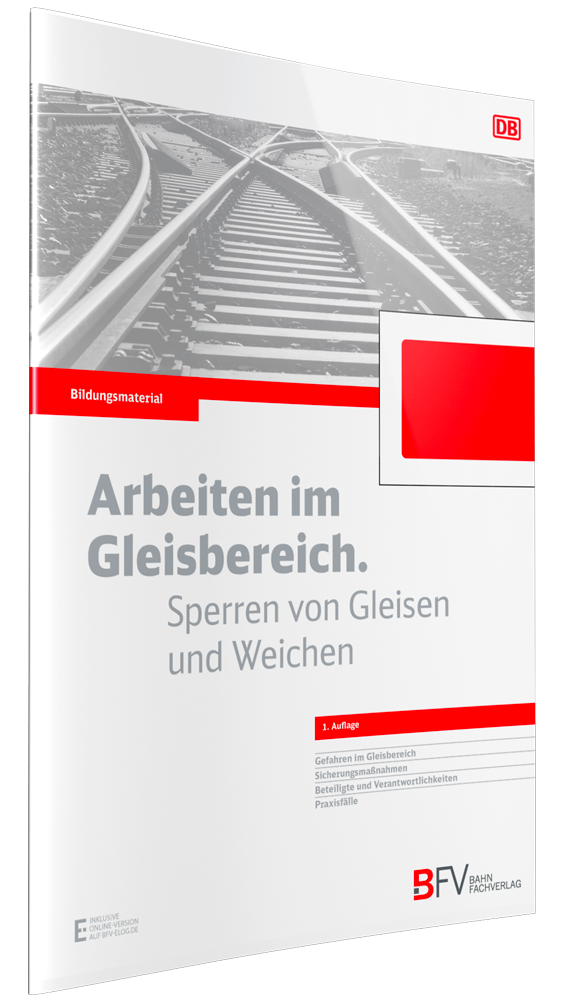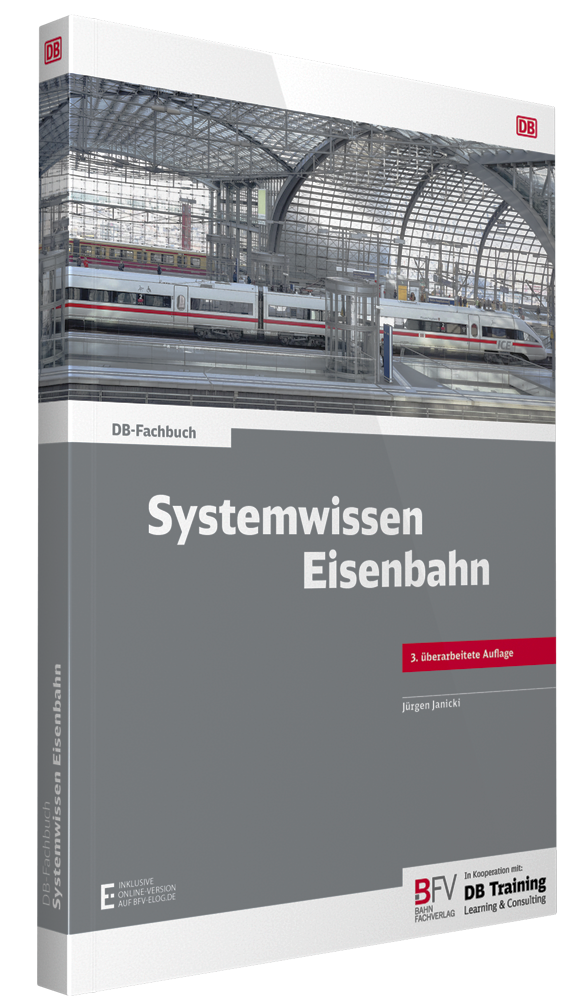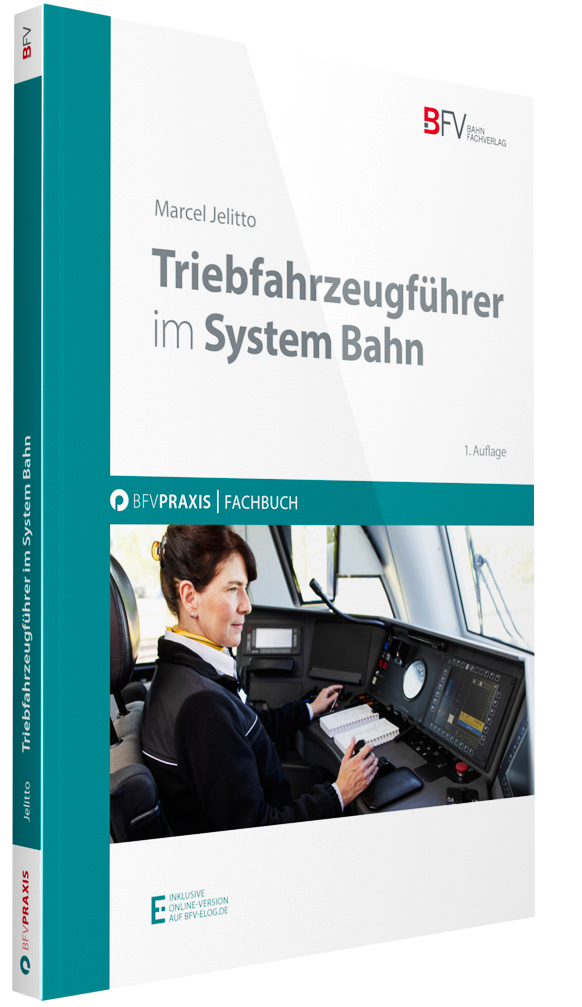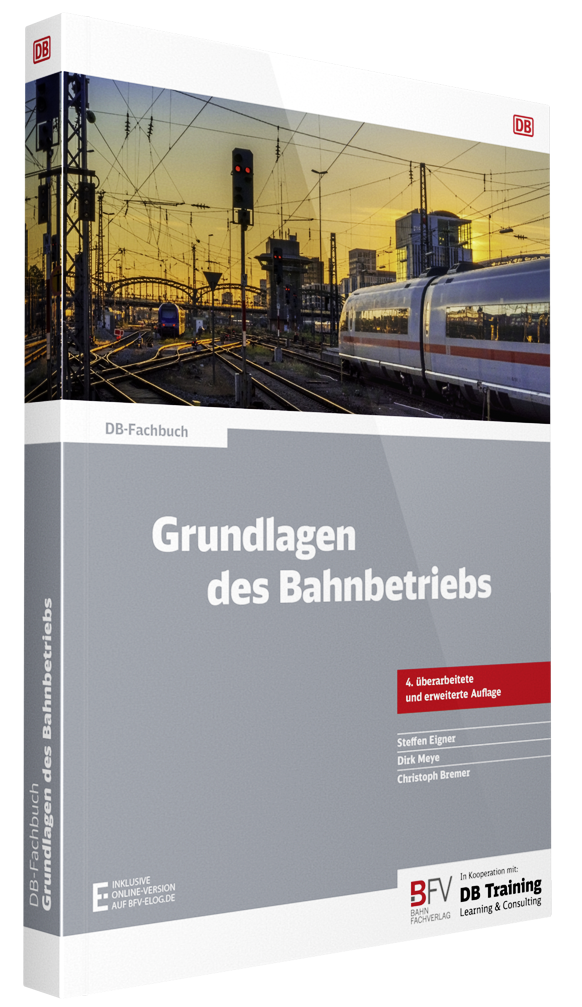Noch unter dem frischen Eindruck der Haushalts- und Regierungskrise zum Jahresende hatte der Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen eine Diskussionsrunde zur Finanzierung und Entwicklung des Schienennetzes auf die Tagesordnung seines Betriebsleiter-Symposiums gesetzt, das im November in Stuttgart stattfand. Außerdem auf dem Programm: Sicherheitskultur in der Praxis, automatisiertes Abstellen von Zügen und Neues aus dem Eisenbahnrecht.
Erst war der Bundeshaushalt geplatzt, dann die noch amtierende Ampel-Regierung. Als kurz darauf Führungskräfte nichtbundeseigener Bahnunternehmen auf Einladung des VDEF in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu ihrem jährlichen Treffen zusammenkamen, war die Diskussion über die möglichen Auswirkungen dieses politischen Bebens auf die Schienenbranche in vollem Gang. Dass sich das Tagungshotel unweit des Stuttgarter Hauptbahnhofs befand, hatte natürlich organisatorische Gründe, doch passte die Kulisse von Dauerbaustelle und Milliardengrab S21 dann doch recht gut zur Lage.
Der Haushalt und die Bahnen, so lautete die Überschrift der Diskussion, die den ersten Kongresstag abschloss. Auf dem Podium versammelt hatten sich Peter Westenberger, Geschäftsführer des Interessenverbands „Die Güterbahnen“, Götz Walther, Betriebsexperte beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Dr. Anne Strohbach, Referatsleiterin bei der Bundesnetzagentur sowie Moderator Horst-Peter Heinrichs, Rechtsanwalt und Regierungsdirektor i.R.
Das große Fragezeichen das im Tagungsraum stand, bezog sich auf die Erwartungen an die künftige Bundesregierung – was würde nach den Neuwahlen von den langfristigen Finanzierungszusagen für die Schiene übrigbleiben? Unstrittig war, dass die gesamte Branche dazu rasch Klarheit braucht, um die Planungssicherheit für die Umsetzung der großen Modernisierungs- und Ausbauvorhaben zu gewährleisten.
Mehr Führung durch den Bund gefragt
Doch der Blick richtete sich nicht nur in die ungewisse Zukunft, sondern auch die gegenwärtige Lage und die jüngste Vergangenheit. Ob die langjährige Unterfinanzierung des Schienennetzes die alleinige Ursache der mangelnden Betriebsqualität ist, wurde in der Runde genauso diskutiert wie die Frage, ob die Überführung der vormaligen Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn in die gemeinwohlorientierte InfraGO AG eine ausreichende Antwort auf die Probleme ist.
Die im Zustandsbericht des Netzbetreibers verwendeten Kennzahlen für die Ursache von Verspätungen seien nicht ausreichend belastbar und transparent, bemängelten die Diskutanten. Ebenso ergibt sich aus ihrer Sicht ein Widerspruch zwischen der Gemeinwohlorientierung und der AG-Konstruktion mit entsprechenden Gewinnabführungspflichten. Hohe Zustimmung im Publikum, dass sich über ein Online-Tool an der Diskussion beteiligen konnte, fand die Aussage, das unzureichende Management der vorhandenen Kapazität durch die DB sei mindestens genauso ursächlich wie fehlendes Geld oder überalterte Technik.
Vorschläge für Verbesserungen bei Steuerung und Finanzierung machten ebenfalls die Runde, wie mehr Anreizregulierung für die beteiligten Unternehmen, eine Stärkung der Position des Bundesverkehrsministeriums nach Schweizer Vorbild oder eine einheitliche Behandlung der Infrastrukturkosten aller Verkehrsträger. Der Bund müsse klar sagen was er will, eine eigene Strategie für die Entwicklung des Schienennetzes aufstellen und mehr Kontrolle über die Verwendung der Mittel für die Schiene ausüben, lautete eine Forderung, über die weitgehende Einigkeit bestand.
Das große Ganze blieb dem Podium vorbehalten – dagegen widmeten sich die Fachvorträge des Symposiums wie gewohnt konkreten betrieblichen und technischen Themen. Werner Uhink von DB Fernverkehr erläuterte, wie Dispositionsprozesse durch digitale Technologien verbessert werden sollen, um für mehr Zufriedenheit bei Reisenden und Personal gleichermaßen zu sorgen und das Unternehmen auch bei angespannter Betriebslage handlungsfähiger zu machen. Ein Beispiel ist die Anwendung DispoMe, welche die Abstimmung zwischen Leitstellen und Zugpersonal einfacher und schneller machen soll.
Überwachen, aber nicht strafen
Uwe Geiger von der DB InfraGO zog ein Zwischenfazit zum Bestreben des Infrastrukturbetreibers, eine Sicherheitskultur zu implementieren, die das gemeinsame Lernen aus Fehlern statt der Suche nach Schuldigen in den Fokus rückt. Der neue sogenannte „Überwachungskreislauf Betrieb“ beinhaltet Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, die sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen geführt werden, um die Hintergründe von Fehlhandlungen des Betriebspersonals zu beleuchten.
Fehler der höchsten Kategorie seien seit Einführung dieser Sicherheitsdialoge bereits zurückgegangen, bilanzierte Geiger, und die anfängliche Skepsis der Mitarbeitenden sei einer positiven Stimmung gewichen. Die Ergebnisse der Gespräche und Untersuchungen fließen in die interne Qualifizierung und die Anpassung von betrieblichen Regelwerken ein.
Fahrerlos ins Abstellgleis
Die Professoren Raphael Pfaff und Bernd Schmidt von der Fachhochschule Aachen knüpften an ihren Vortrag aus 2022 an, in dem sie das teilautomatisierte Rangieren von Güterzügen mit dem System SAMIRA vorgestellt hatten. Sein Pendant für den Vorbereitungs- und Abstelldienst hört auf den Namen SAMU, was für „Stabling automation for multiple units“ steht.
Die Herausforderungen und die Umsetzung sind ähnlich: Die Arbeitsplätze im Zugbetrieb sollen attraktiver und die Mitarbeitenden entlastet werden – durch geeignete technische Lösungen, die KI-gestützte Umfelderkennung einsetzen und ansonsten auf konventioneller Technik beruhen, um aufwendige Neuzulassungen zu vermeiden. Im Fall von SAMU ist das Ziel ein eingeschränkter Betrieb auf Automatisierungsstufe (GoA) 4, der ein Triebfahrzeug ohne Mitwirkung des Fahrzeugführenden vom Abstellgleis zum Bahnsteig und zurück führt.
VDV-Rechtsexperte Markus Ring bot den Teilnehmenden einen Überblick über die Branche betreffende Entscheidungen und laufende Verfahren bei Gerichten und Gesetzgeber. Darunter war das Betriebsverbot lauter Güterwagen auf leiseren Strecken, das im Dezember in Kraft getreten ist, sowie die Auswirkungen der teilweisen Legalisierung von Cannabis – hier spricht sich der VDV klar für eine Beibehaltung der Null Toleranz-Politik im Schienenverkehr aus (siehe ausführlicher zu beiden Themen die Januar-Ausgabe von Deine Bahn).
Zur im vergangenen Jahr novellierten Triebfahrzeugführerscheinverordnung befindet sich der VDV im Dialog mit dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA), erläuterte Ring, und rief die Anwesenden dazu auf, dem Verband eventuell aufgetretene Probleme in der Praxis zu berichten (siehe auch den Beitrag auf S. 21 in dieser Ausgabe).
Ring ging weiter auf die häufige Frage ein, wie die EBA-Fachmitteilungen zu bewerten sind, und stellte klar: diese sind keine Regeln oder Vorschriften, sondern haben den Charakter von Empfehlungen.
Während die Behörde beaufsichtigt, obliegt die praktische Umsetzung der Betriebssicherheit den Unternehmen, die einen Gestaltungsspielraum haben und auch von diesen Empfehlungen abweichen können.
Lesen Sie auch:
Artikel als PDF laden